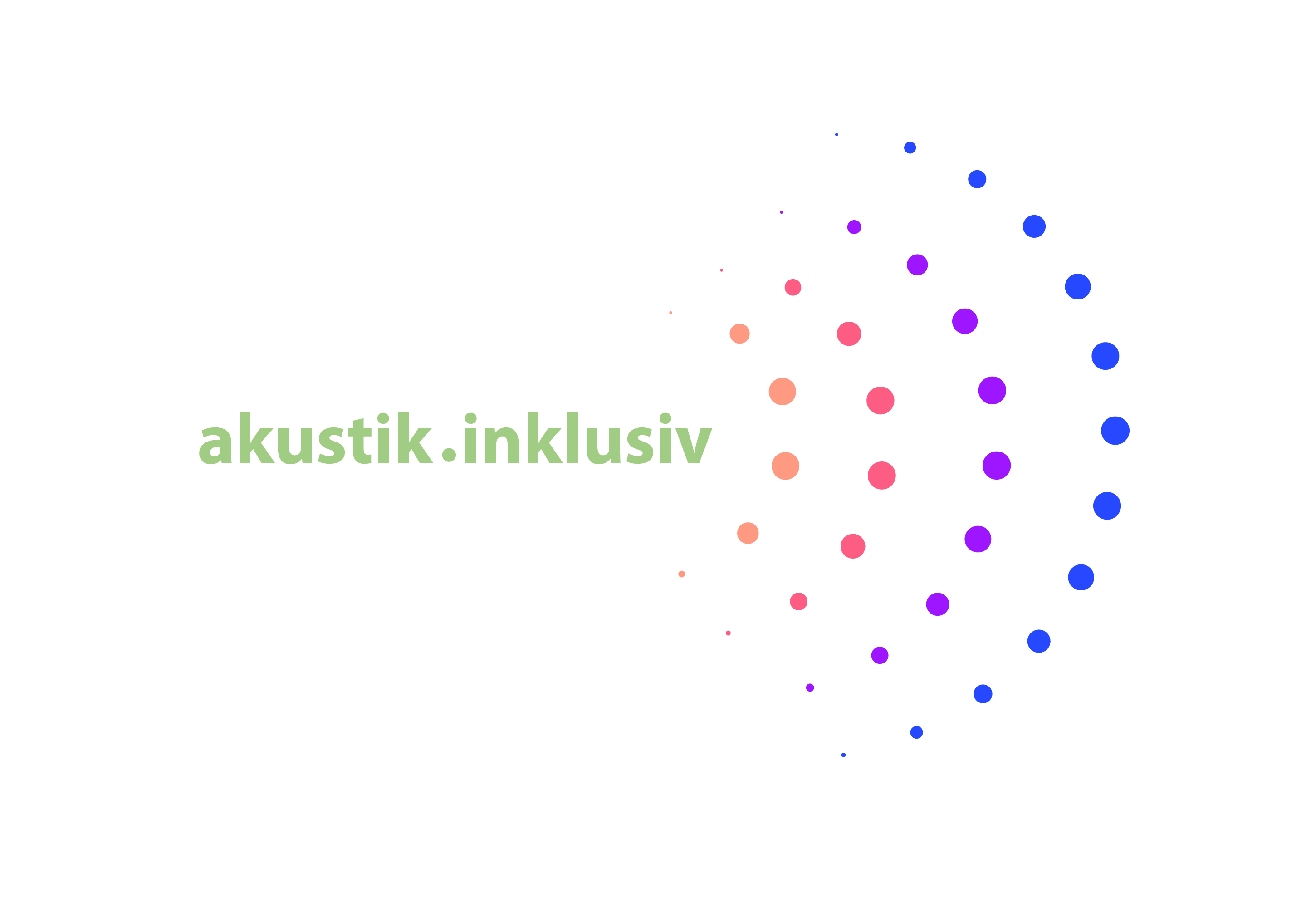Raumakustik
Die Raumakustik ist ein entscheidender Aspekt in der Gestaltung von Räumen, der oft übersehen wird, aber eine erhebliche Auswirkung auf die Inklusion und auch der Gesundheit haben kann.
Die Qualität der Akustik eines Raumes kann darüber entscheiden, ob Menschen sich darin wohl fühlen, effektiv kommunizieren und sich gleichberechtigt am sozialen Leben beteiligen können. Eine inklusive Raumakustik berücksichtigt die Bedürfnisse aller Personen, unabhängig von ihrem Gehörstatus, ihrer Sprache oder anderen individuellen Merkmalen.
In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, Maßnahmen zu ergreifen, um akustische Barrieren abzubauen und sicherzustellen, dass jeder die Möglichkeit hat, aktiv am Raumgeschehen teilzunehmen und sich verstanden zu fühlen.

Auswirkungen auf die Inklusion
Eine schlechte Raumakustik kann erhebliche Auswirkungen auf die Inklusion haben, da sie die Fähigkeit der Menschen
beeinträchtigt, effektiv zu kommunizieren, sich wohl zu fühlen und sich gleichberechtigt am sozialen Leben zu
beteiligen. Wenn ein Raum eine ungünstige Akustik aufweist, können verschiedene Probleme auftreten, die die
Inklusion beeinträchtigen:
Kommunikationsbarrieren
Eine schlechte Raumakustik kann dazu führen, dass Geräusche verstärkt oder verzerrt werden, was die Verständlichkeit von gesprochener Sprache beeinträchtigt.
Dies kann insbesondere für Personen mit Hörbeeinträchtigungen oder Sprachschwierigkeiten zu erheblichen Kommunikationsbarrieren führen und sie daran
hindern, aktiv am Gespräch teilzunehmen.
Soziale Ausgrenzung
Menschen, die aufgrund der Raumakustik Schwierigkeiten haben, sich in einem Raum zurechtzufinden oder sich verstanden zu fühlen, können sich aus sozialen Interaktionen zurückziehen.
Dies kann zu Gefühlen der Ausgrenzung und Isolation führen, insbesondere wenn andere Teilnehmer*innen des Raumes nicht
sensibilisiert sind für die Bedürfnisse derjenigen mit akustischen Herausforderungen.
Leistungsbeeinträchtigung
In Umgebungen mit schlechter Raumakustik können sich die Konzentration und die kognitiven Fähigkeiten verringern, da Personen mehr Energie darauf verwenden müssen, um Sprache zu verstehen oder störende Geräusche zu filtern.
Dies kann zu einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit in schulischen, beruflichen oder anderen Umgebungen führen.
Gefühl von Unbehagen
Eine ungünstige Raumakustik kann auch dazu führen, dass sich Menschen unwohl fühlen oder sogar physische Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Stresssymptome entwickeln.
Die Folge ist, dass Personen den Raum vermeiden oder sich nicht vollständig auf ihre Aufgaben konzentrieren können.
Insgesamt ist es wichtig zu erkennen, dass eine gute Raumakustik ein wesentlicher Bestandteil einer inklusiven
Umgebung ist. Indem wir die Akustik eines Raumes verbessern und sicherstellen, dass sie die Bedürfnisse aller
Personen berücksichtigt, können wir eine Umgebung schaffen, die für alle zugänglich, unterstützend und förderlich für
die Teilnahme und das Wohlbefinden ist.
Auswirkungen auf die Gesundheit
Raumakustik hat einen direkten Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen, da sie die Qualität
der akustischen Umgebung in Innenräumen beeinflusst. Eine schlechte Raumakustik, die durch störende Echos, hohe
Lärmpegel oder eine unzureichende Sprachverständlichkeit gekennzeichnet ist, kann verschiedene negative
Auswirkungen auf die Gesundheit haben.
Studien* zeigen, wozu Lärm führen kann:
Stress
Erhöter Blutdruck
Schlafstörungen
Konzentrationsprobleme
Der ständige Kampf, störende Geräusche zu filtern oder Sprache zu verstehen,
kann zu einer erhöhten Belastung des Gehirns führen und das Risiko von kognitiven Beeinträchtigungen erhöhen.
Besonders betroffen von einer schlechten Raumakustik sind Menschen, die an Hörproblemen leiden, da sie noch
stärker auf eine klare und verständliche Sprachübertragung angewiesen sind. Eine angemessene Raumakustik ist daher
entscheidend, um sicherzustellen, dass Menschen mit Hörbeeinträchtigungen gleichberechtigt am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen können und keine zusätzlichen Ausgrenzungen erfahren.
Durch die Gestaltung von Räumen mit einer guten Raumakustik, die eine angenehme akustische Umgebung schafft und
eine klare Sprachverständlichkeit gewährleistet, können wir das Wohlbefinden und die Gesundheit aller Menschen
fördern. Eine angenehme akustische Umgebung trägt dazu bei, Stress zu reduzieren, die Konzentration zu verbessern
und die Lebensqualität insgesamt zu steigern.
*Studien-Quelle: WHO Noise Guidelines 2018

Raumakustik und Inklusion in Normung und Recht
Die Raumakustik spielt eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention,
da sie direkte Auswirkungen auf die Barrierefreiheit und Inklusion hat. Gemäß den Grundsätzen
der Konvention sollen Menschen mit Behinderungen uneingeschränkten Zugang zu Räumen haben
und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.
Zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist die DIN 18041 – Hörsamkeit in Räumen der
Maßstab in der Raumakustik. Diese Norm ist von entscheidender Bedeutung für die Förderung der
Inklusion, da sie klare Richtlinien und Standards festlegt, um sicherzustellen, dass die akustische
Umgebung in verschiedenen Räumen für alle Menschen zugänglich und angenehm ist, unabhängig
von ihren individuellen Bedürfnissen.
Zudem ist sie das anerkannte technische Regelwerk in der Raumakustik und der Maßstab der zu
erfüllen ist wenn es um die akustische Gestaltung von Räumen geht.
Zudem gibt es noch die ASR 3.7 – Lärm, welche u.a. die raumakustischen Anforderungen zur Erfüllung
des Arbeitsschutzes definiert.
Insgesamt spielen Normung und Recht eine entscheidende Rolle dabei, eine angemessene Raumakustik
zu gewährleisten und die Bedürfnisse aller Nutzer*innen zu berücksichtigen. In dem Normen und Gesetze
eingehalten werden, können wir Räume schaffen, die für alle zugänglich, komfortabel und förderlich für die
Teilnahme und das Wohlbefinden sind.
Ist die Akustik innerhalb eines Raumes objektiv beurteilbar?
Defintiv.
Die Nachhallzeit ist dabei die bedeutendste Kenngröße und
sie ist messbar mittels speziellen Messgeräten.
Sie gibt an in welcher Zeit ein Schallsignal um 60dB abfällt. Kurze Nachhallzeiten
bedeuten, dass der Raum leiser ist und und eine bessere Sprachverständlichkeit
aufweist. Lange Nachhallzeiten führen zu einem halligen und lauten Raum.
Die Nachhallzeit hängt von der Raumgröße und Geometrie, der Einrichtung und
den Materialien der Wände, sowie der Decke ab.
Es ist wichtig, die Nachhallzeit zu berücksichtigen, um sicherzustellen,
dass der Raum akustisch angenehm ist und die Kommunikation nicht gestört wird.

Maßnahmen für eine hörgerechte Akustik
Maßnahmen der Raumakustik sind entscheidend für die Förderung von Inklusion, indem sie sicherstellen,
dass Räume für alle Menschen zugänglich und angenehm sind, unabhängig von ihren individuellen
Bedürfnissen. Einige wichtige Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik und Förderung von
Inklusion sind:
1.
Akustische
Behandlungen
Die Verwendung von
akustischen
Materialien wie
schallabsorbierenden
Wandpaneelen, Deckenfliesen
oder Bodenbeläge, kann dazu
beitragen, die Nachhallzeit
zu reduzieren und die
Sprachverständlichkeit
zu verbessern.
2.
Technologische
Lösungen
Die Integration von
Technologien wie beispielsweise
Induktionshöranlagen,
kann Menschen mit
Hörbeeinträchtigungen
helfen, Sprache klarer
zu verstehen und
aktiv am Gespräch
teilzunehmen.
3.
Raumgestaltung
Die Gestaltung von
Räumen unter
Berücksichtigung der
Akustik kann dazu
beitragen, Lärmpegel zu kontrollieren und eine
angenehme Umgebung
zu schaffen, die für alle
Nutzer geeignet ist.
4.
Sensibilisierung und
Schulung
Schulungen über die
Bedeutung einer inklusiven Raumakustik
können dazu beitragen,
das Bewusstsein für die Bedürfnisse verschiedener
Nutzergruppen zu schärfen
und die Umsetzung
entsprechender
Maßnahmen
zu fördern.
Indem diese Maßnahmen in der Planung, Gestaltung und Ausstattung von Räumen berücksichtigt
werden, können wir eine Umgebung schaffen, die für alle zugänglich, komfortabel und förderlich für die
Teilnahme und das Wohlbefinden ist.
Warum speziell Raumakustik und Inklusion?
Die inklusiven Anforderungen der Raumakustik gemäß dem anerkannten technischen Regelwerk DIN 18041:2016 für Hörsamkeit in Räumen setzen einen Standard für die raumakustische Gestaltung öffentlich zugänglicher Gebäude, der sich auf die UN-Behindertenrechtskonvention bezieht.
Es sollte daher selbstverständlich sein, inklusiv zu beraten und zu planen, da Inklusion das Ziel hat, dass wir nicht mehr in Schubladen denken. Leider ist dieser Sachverhalt noch nicht überall angekommen,
weshalb beispielsweise Schulen und Kitas oft nicht inklusiv geplant und entsprechende Lösungen umgesetzt werden.
Dies beeinträchtigt insbesondere diejenigen, die besonders auf eine inklusive akustische Gestaltung von Räumen angewiesen sind und den geringsten Einfluss auf Veränderungen haben.
Bei akustik.inklusiv sehen wir es als unsere Aufgabe, nicht nur Abhilfe bei schlechter Akustik zu schaffen, sondern auch hinsichtlich inklusiver Akustik zu beraten und zu informieren. Zudem erfüllen inklusive raumakustische Anforderungen höhere Standards als die vom Arbeitsschutz nach der ASR 3.7 Lärm vorgegebenen Anforderungen. Werden also die inklusiven Anforderungen erfüllt, sind auch die raumakustischen Anforderungen des Arbeitsschutzes gewährleistet, was sich positiv auf die Gesundheit der Mitarbeiter*innen und aller Nutzer*innen auswirkt.
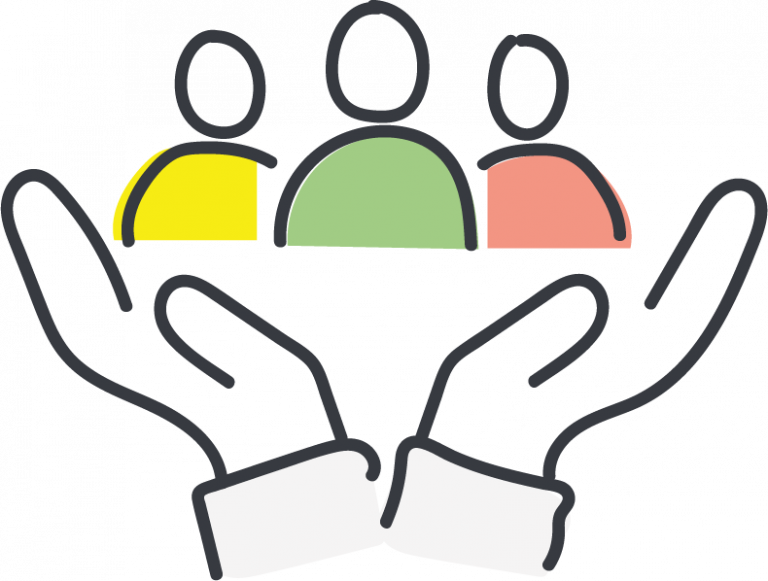

Beleuchtung in der Raumakustik
Wie passt Beleuchtung und Akustik zusammen? Menschen mit einer Hörbehinderung gleichen Ihre Höreinschrenkung visuell aus. Das bedeutet sie sind besonders auf gute Sichtverhältnisse angewiesen. Und Licht ist dabei ein entscheidender Faktor.
Ebenso gleichen Sehbehinderte ihre Seheinschränkung durch ihr Gehör aus und sind entsprechend auf eine inklusive Akustik angewiesen. Es handelt sich hierbei um das sog. „Zwei-Sinne-Prinzip“. Hierbei müssen zwei der drei Sinne (Sehen, Hören, Tasten) angesprochen werden. Daher ist die Einhaltung dieses Prinzips wichtig für eine möglichst barrierefreie Gestaltung von Räumen. Dementsprechend sollte bei einer inklusiven Planung beide Seiten mit einbezogen werden.
Beide Aspekte werden heute überwiegend noch getrennt betrachtet, welches auf fehlende Hinweise in den einschlägigen Normen zurückzuführen ist. Für natürliche und künstliche Beleuchtung gibt es wie in der Raumakustik genauso Technische Regelwerke, welche die Standards definieren und umzusetzen sind.
© 2024 akustik.inklusiv